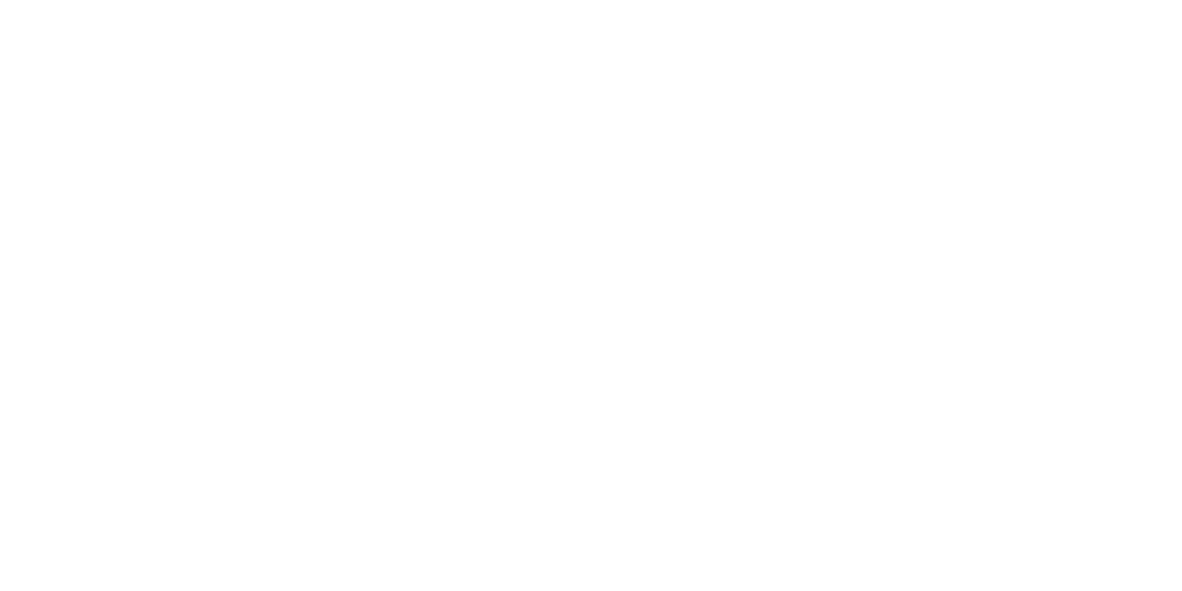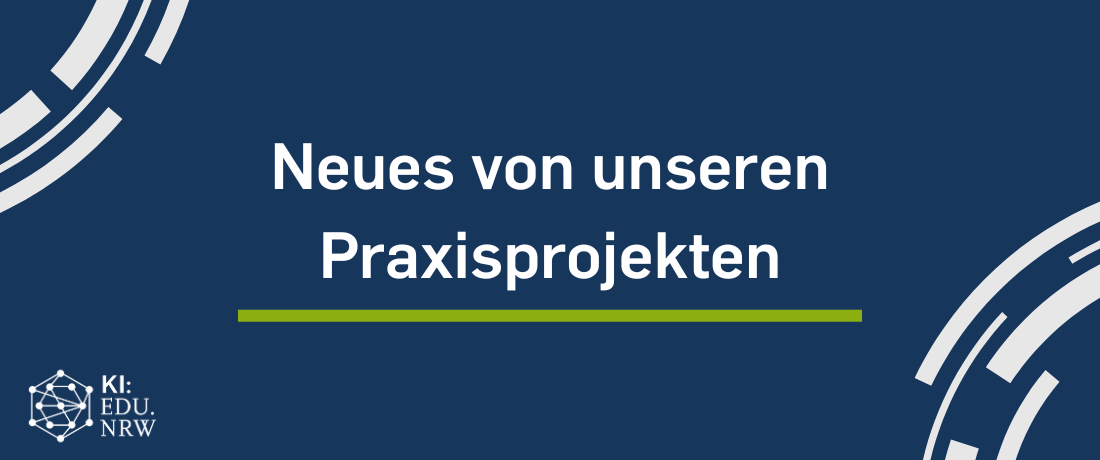
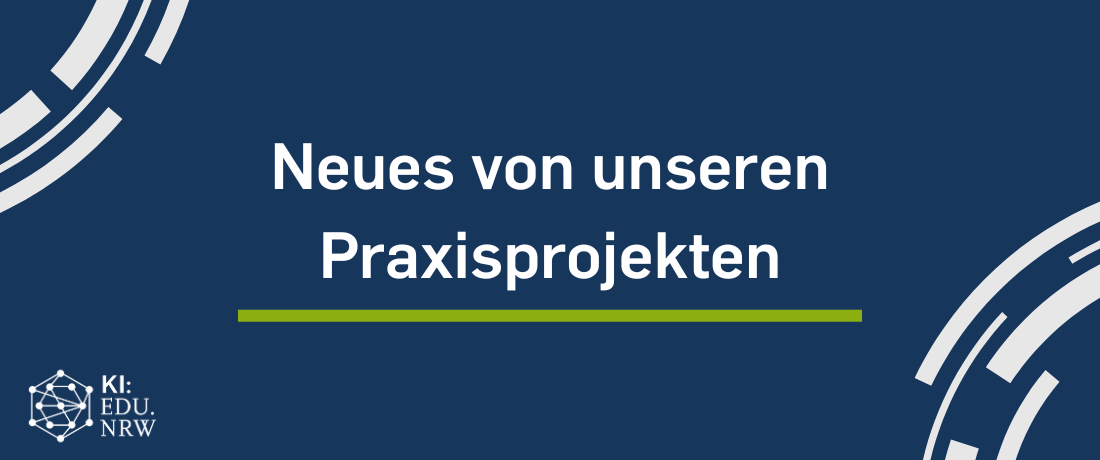
KIMu_lab, ki.StadtLabor, Sokratest, TermRAG 4 SafeAI und XLM – das sind die fünf Praxisprojekt der ersten Förderphase von KI:edu.nrw. Doch was genau machen die eigentlich? In unserer neuen Serie berichten wir in regelmäßigen Abständen über die Arbeit der Projekte. Den Auftakt macht heute das ki.StadtLabor, das im Februar 2025 an den Start gegangen ist.
Im ki.StadtLabor starten Studierende ihren Entwurfsprozess nicht am Schreibtisch, sondern mitten in der Stadt. Ein gemeinsamer Stadtspaziergang wird zum kreativen Ausgangspunkt für die Arbeit mit generativer KI. Analoge Raumerfahrung trifft auf digitale Werkzeuge, um einen neuen Zugang zur Architektur und Stadtbaukunst zu eröffnen.
Wie lässt sich generative KI sinnvoll in die Architekturlehre integrieren? Im ki.StadtLabor der Technischen Universität Dortmund beginnt die Antwort vor Ort – in der gebauten Umwelt. Ausgehend von der Entwurfsaufgabe, eine Baulücke im Dortmunder Kaiserviertel zu gestalten, markiert der gemeinsame Stadtspaziergang den Startpunkt eines kreativen Prozesses, der analoge Raumerfahrung mit digitaler Modellierung verbindet.
Der Spaziergang liefert die sinnliche und konzeptionelle Basis für den gesamten Entwurfsprozess. Beobachtungen, Skizzen und Fotografien werden gesammelt, kritisch reflektiert und mithilfe generativer KI-Modelle in atmosphärische Visualisierungen übersetzt.
Im ki.StadtLabor entstehen Bilder, Texte, Pläne und Raumkonzepte durch den gezielten Einsatz generativer KI-Modelle. In Verbindung mit analogen Gestaltungstechniken wie der Handskizze oder dem Stadtspaziergang entsteht ein hybrider Arbeitsraum, in dem Studierende neue Entwurfsmethoden erarbeiten, erproben und kritisch reflektieren.
Alle Infos zum KI:edu.nrw-Praxisprojekt gibt es hier.
Die Exkursion ist ein wirkungsvolles Instrument, um Architektur und Stadt mit allen Sinnen zu begreifen. Sie fordert die Teilnehmenden dazu auf, ihre Umgebung aktiv und kritisch zu erkunden. Die persönliche Erfahrung mit dem Stadtraum regt dazu an, über eine rein analytische Betrachtung von Architektur hinauszugehen und sensibilisiert für atmosphärische Qualitäten, subjektive Raumerlebnisse und die emotionale Wirkung von Raum.
Durch gezielte Beobachtung und Analyse nähern sich die Studierenden ersten Themen wie Materialität, Proportion oder Atmosphäre. Sie lernen, nicht nur Formen und Funktionen zu erfassen, sondern auch räumliche Stimmungen zu deuten. Erste Skizzen, Fotos und Notizen dokumentieren ihre Eindrücke – und bilden die Grundlage für die anschließende Arbeit mit generativer KI.
Die Verbindung von analogem Erlebnis und digitaler Transformation ist zentrales Merkmal des ki.StadtLabors. Mithilfe multimodaler Diffusionsmodelle werden die Skizzen und Fotografien in realistische Visualisierungen überführt. Multimodal bedeutet dabei, dass verschiedene Eingabemedien – wie Texte oder Bilder – gleichzeitig verarbeitet und kombiniert werden können. Dabei lernen die Studierenden sowohl das klassische Handwerk der präzisen Handzeichnung als auch den reflektierten Einsatz digitaler KI-Tools.
So entstehen atmosphärische Stadträume, die sowohl den Charakter des Ortes einfangen als auch neue gestalterische Ansätze sichtbar machen. Die Anwendung generativer Künstlicher Intelligenz wird dabei nicht als Ersatz für die klassische Entwurfsarbeit verstanden, sondern als dessen Erweiterung. Ziel ist es, den eigenen Gestaltungsprozess zu reflektieren, neue Möglichkeiten auszuloten – und kreative Spielräume mutig zu nutzen.
Die Diffusionsmodelle arbeiten in zwei Phasen: Sie lernen im Training, wie Bilder schrittweise „verrauscht“ werden, bis nur noch ein zufälliges Muster übrig bleibt – und wie man diesen Prozess wieder umkehren kann. Bei der Generierung wird dieses Wissen genutzt, um aus einem Rauschbild in vielen kleinen Schritten ein klares, realistisches Bild zu formen. Dabei fügt die KI gezielt Inhalte hinzu, die zu den vorgegebenen Texten, Skizzen oder Fotos passen. Man kann sich das vorstellen wie einen Bildhauer, der einen Stein (das Rauschen) Schritt für Schritt in die gewünschte Form meißelt.
Prompt: A realistic central shot of a modern white townhouse facade in sunlight, with dark window frames, reflective glass panes catching the sunlight, neighboring buildings closely attached on both sides, and a cozy small bookstore on the ground floor with large storefront windows and plants inside, photorealistic, the light-colored plaster facade is structured with soft shadow lines and features a central rectangular bay window (Erker) and a defined cornice (Traufe). Four small, flat-roofed dormer windows (Dachgauben) are symmetrically integrated into the dark roof. Window frames are slim and dark-colored. The ground floor hosts a small independent bookstore with large glass display windows and a modern central entrance door
Anastasia Schmidt arbeitet mit Flux in Kombination mit ComfyUI, einem innovativen Open-Source-Tool zur KI-gestützten Bildgenerierung. Ihre handgezeichneten Skizzen überführt sie Schritt für Schritt in fotorealistische Visualisierungen. Für das Grundstück im Kaiserviertel entwirft sie ein urbanes Wohnhaus mit Gewerbenutzung im Erdgeschoss.
Prompt: Eye-level interior view of a small, intimate music room in a daycare center. A care-Eye-caregiver plays the piano against a raw concrete wall, while children sit in a circle on giver small chairs, joyfully shaking maracas, tapping drums, or clapping to the rhythm. The opposite wall features large glass block windows, softly illuminating the scene with diffused light. The room feels alive with sound and movement. The photowith photograph has a warm, nostalgic analog aesthetic, as if taken with an old camera. graph Photographed in the style of William Eggleston, shot with a vintage Polaroid SX-70 + flash.+ flash.
Mohamed Abu-Subeih kombiniert analoge und textbasierte Ansätze: Er beginnt mit eigenen Skizzen, die er detailliert beschreibt – Materialien, Proportionen, Nutzungsszenarien. Aus diesen Beschreibungen entwickelt er präzise Prompts für Midjourney. Für das Baugrundstück entwirft er einen Kindergarten, dessen Gestaltung von transluzenten Glasbausteinen geprägt ist.
Im Wechselspiel zwischen Mensch und Maschine entwickeln die Studierenden erste Raumideen. Sie erstellen Bildreihen, die in mehreren Iterationen verfeinert werden, und erproben dabei eigene Methoden und Arbeitsweisen im Umgang mit generativer KI. Skizzen, Texte und digitale Zwischenstände werden gezielt weiterentwickelt und im gemeinsamen Kolloquium kritisch reflektiert.
So entsteht Schritt für Schritt ein eigenständiger architektonischer Entwurf. Zwischen gestalterischer Intuition, digitaler Transformation und konzeptioneller Reflexion wachsen Ideen zu räumlichen Konzepten heran – fundiert im Ausdruck und bewusst in der Methode.
Eva Marie Scheerbaum: „Die Baulücke, das „Fenster zum Hinterhof“, wird im Projekt nicht geschlossen, sondern durch eine temporäre Gerüstinstallation künstlerisch aufgegriffen. Sie schafft Raum für Aneignung und Sichtbarkeit.”
Noah Mährmann entwickelt für die Baulücke eine Kinderbetreuung in leichter Holzbauweise. Warme Farben, natürliche Materialien und farbige Stoffe prägen den Entwurf. Durch transluzente Elemente und bewegtes Licht entsteht eine lebendige Atmosphäre.
Die Teilnehmenden lernen, generative KI nicht nur technisch zu beherrschen, sondern auch kritisch zu hinterfragen. Sie setzen sich mit den Potenzialen und Grenzen digitaler Werkzeuge auseinander und entwickeln eigene gestalterische Strategien. Das ki.StadtLabor fördert dabei nicht nur digitale Kompetenzen, sondern schärft auch das gestalterische Urteilsvermögen und die konzeptionelle Selbstständigkeit der Studierenden.
Zum Einsatz kommen verschiedene multimodale Modelle wie Flux.1, DALL·E, Midjourney, Stable Diffusion oder ChatGPT. Die inhaltlichen und medialen Schwerpunkte wählen die Studierenden selbst – von atmosphärischen Bildwelten über architektonische Narrative bis hin zu KI-generierten Planzeichnungen und Videos.
Das ki.StadtLabor ist als Wahlpflichtfach im Studiengang Architektur und Städtebau verankert und fest in die gestalterisch-künstlerische Ausbildung eingebunden. Mit einer begrenzten Teilnehmerzahl von 20 Personen bietet der Kurs Raum für intensive Betreuung, individuelle Entwicklung – und experimentelles Arbeiten. Die erarbeiteten Methoden und Strategien fließen auch in andere Lehrformate ein und bereichern das Studium auf breiter Ebene.
Am Ende des Semesters präsentieren die Studierenden ihre Projekte im Rahmen eines öffentlichen Kolloquiums. Jedes Projekt umfasst ein stimmiges Gesamtkonzept aus Bildern, Plänen und begleitenden Texten. Gerade im Zusammenspiel mit KI bleibt dabei eines zentral: die architektonische Urteilskraft, Intuition und Verantwortung der Entwerfenden.
Bildnachweise
Gruppenbild & Stadtspaziergang: Felix Flüß, Technische Universität Dortmund
Abschlussbild: Mert Büyüktüfekci, Technische Universität Dortmund