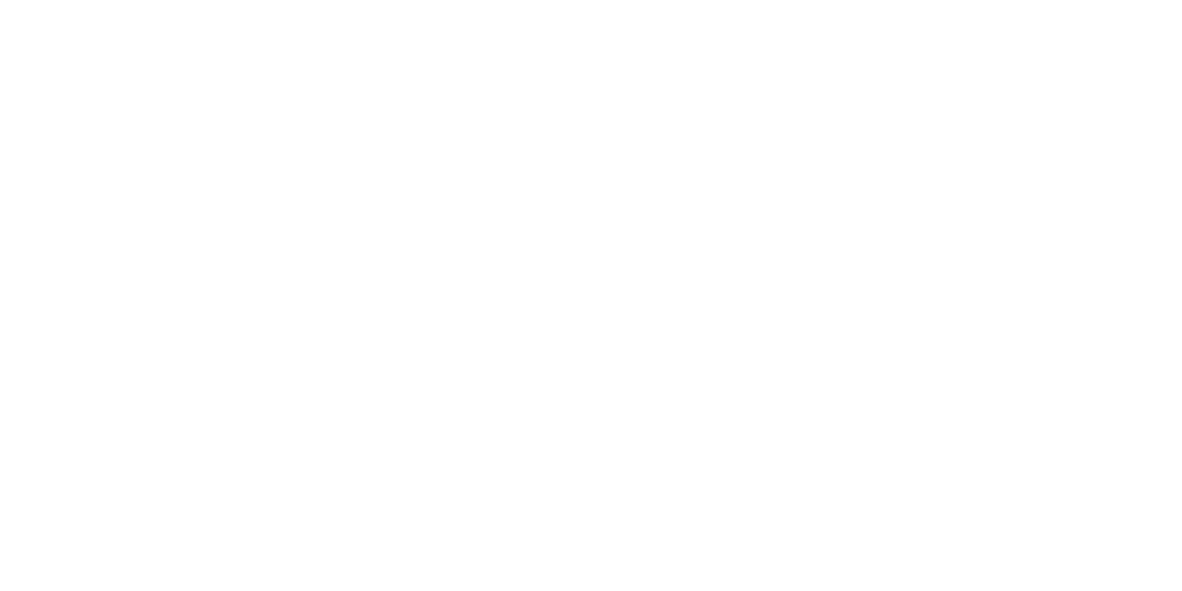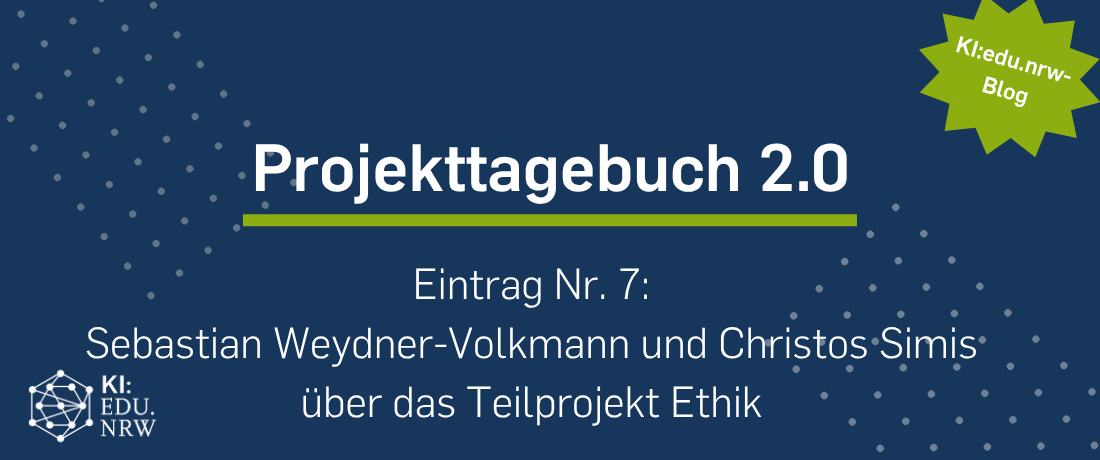
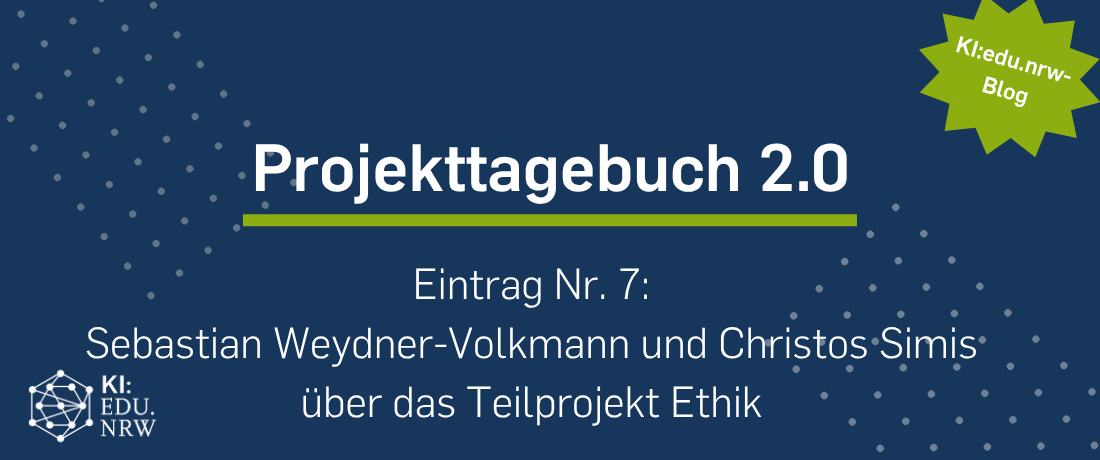
Ethik ist uns allen wahrscheinlich erstmal ein geläufiger Begriff: die philosophische Lehre vom richtigen Handeln – sie fragt, was gut, gerecht und verantwortungsvoll ist, und warum wir so handeln sollten. Doch was bedeutet Ethik im Projektkontext von KI:edu.nrw? Was sind die Herausforderungen? Und wie kann ethische Reflexion im Projekt gelingen? Auf diese und weitere Fragen wissen Sebastian Weydner-Volkmann und Christos Simis aus dem KI:edu.nrw-Teilprojekt Ethik die Antwort.
Wir sind Christos Simis (they/them bzw. keine Pronomen) und Sebastian Weydner-Volkmann und in KI:edu.nrw bearbeiten wir das Teilprojekt Ethik. Wir kommen beide aus der Philosophie, dort hat Sebastian seit 2020 die Juniorprofessur für Ethik der Digitalen Methoden und Techniken inne, Christos ist 2021 wissenschaftlich mitarbeitend in den Arbeitsbereich dazugestoßen. Unsere Aufgabe ist es, mit Blick auf die Nutzung von „KI“* in der Hochschulbildung ethische Denkanstöße zu geben, andere Perspektiven zu eröffnen, Blind Spots aufzudecken, insbesondere aber auch forschungsbasierte Werkzeuge und Ressourcen für eine ethische Reflexion bereitzustellen.
Bereits beim Ausdruck „Künstliche Intelligenz“ oder „KI“ lassen sich ethisch relevante, reflexionsbedürftige Aspekte finden. Durch diesen Ausdruck wird einer Technologie eine (menschliche) Eigenschaft zugeschrieben, nämlich Intelligenz. Dieses Phänomen ist bekannt als Anthropomorphisierung und stellt eine Form von Bias dar. Denn eine solche Zuschreibung kann zu Verzerrungen führen, z.B. mit Blick darauf, was Technologien tatsächlich können und was nicht. Die Verwendung von Einführungszeichen beim Ausdruck „KI“ soll als Irritation dienen, um die Reflexion des „KI“-Ausdrucks anzustoßen. Zu diesem Thema hat sich eine projektinterne Arbeitsgruppe gebildet.
Sebastian: Im Rahmen der Arbeit des Teilprojekts Ethik, die insbesondere Christos übernommen hat, werden zwei Arten von Ressourcen entwickelt. Einerseits sind mehrere Handreichungen entstanden, um eine erste Orientierung für die ethische Reflexion zu bieten. Eine erste Handreichung vermittelt wichtige Grundlagenkenntnisse für eine Technikethik, zwei weitere Handreichung gehen dann spezifischer auf die Aspekte von Learning Analytics und generativen Technologien (oft unter dem Ausdruck „generative KI“ subsumiert) ein. Die Handreichungen dienen als Einstieg in die ethische Reflexion, indem sie einen konzeptuellen Rahmen bieten und in Begriffe, Methoden und Theorien, die für eine ethische Reflexion hilfreich sei können, einführen. Andererseits wird über Workshops die Möglichkeit geboten, Methoden und Werkzeuge ethischer Reflexion begleitend zu erproben.
Christos: Im Mittelpunkt eines kompetenzbasierten Ethikkonzepts steht nicht die reine Vermittlung von Kenntnissen zu ethischen Debatten und Ansätzen, sondern die Aus- und Einübung bestimmter Fähigkeiten zur ethischen Reflexion. Das heißt: Der Erwerb ethischer Kompetenzen ermöglicht Akteur*innen, seien es Studierende oder Lehrende, ihren Umgang mit „KI“ im jeweils eigenen Kontext ethisch zu reflektieren.
Sebastian: Ja, damit wollen wir dem Problem gerecht werden, dass Einschätzungen zu Wertfragen beim Einsatz von Technik enorm abhängig von der konkreten Situation sind, sich also selten für alle möglichen Einsätze verallgemeinern lassen. Eine bloße Compliance mit von uns oder jemand anderem definierten Prinzipien und Regeln stößt also sehr schnell an ihre Grenzen. Stattdessen soll die Vermittlung grundlegender ethischer Kompetenzen das Verantwortungsbewusstsein im Umgang mit „KI“ in der Hochschulbildung fördern.
Christos: Die ersten zwei Handreichungen (Grundlagen und Learning Analytics) sind schon 2024 veröffentlicht. Die dritte Handreichung zu generativen Technologien wurde jetzt vor Kurzem veröffentlicht. Zugleich wurde ein erster Ethik-Workshop zu Grundlagen ethischer Reflexion durchgeführt. Ein zweiter darauf aufbauender Vertiefungsworkshop ist aktuell in der Vorbereitung.
Christos: Kurze Antwort: ganz unterschiedlich. Die Zusammenarbeit gestalten wir bedarfsorientiert. Manchmal kann es ein themenspezifischer bilateraler Austausch sein. Dann kann es Zusammenarbeit im Rahmen einer Arbeitsgruppe sein. Der gemeinsame Nenner ist, dass die Zusammenarbeit dialektisch und auf Augenhöhe erfolgt.
Christos: Allerdings. Die Handreichungen sind so aufbereitet, dass sie von jeder Person genutzt werden können. Methodisch sind sie interaktiv so gestaltet, dass anhand von Fragen und Übungen die Reflexion im eigenen Kontext gefördert wird. Denn die Spezifizierung des Kontexts ist Bestandteil der ethischen Reflexion. Zugleich sind die beinhalteten Impulse allgemein genug gehalten, um in vielen verschiedenen Situationen mit möglichst geringer Anpassung anwendbar zu sein.
Sebastian: Von Beginn an war eine der größten Herausforderungen, ethisches Fachwissen für Fachfremde zugänglich zu machen. Dafür ist eine enorme Übersetzungsarbeit nötig! Oft wirkt die philosophische Fachsprache unserer Alltagssprache ja sehr nah – und über Werte denken wir ja alle ständig nach, da fühlen wir uns kompetent. Weil sich hinter der philosophischen Fachsprache oft komplexe, methodisch entwickelte Ansätze verbergen, ist eine sorgfältige Aufbereitung nötig, damit sie sinnvoll vermittelt und angewendet werden können
Christos: Darüber hinaus ist es auch grundsätzlich eine große Herausforderung, grundlegende und tiefgreifende Annahmen des eigenen Verhaltens zu hinterfragen und zu problematisieren bzw. überhaupt erst einmal sichtbar zu machen. Teil des Problems ist ja, dass bei der Entwicklung und dem Einsatz von „KI“ in der Hochschulbildung vieles erstmal selbstverständlich wirkt und ganz nahe liegt. Erst in der ethischen Reflexion entwickelt sich dann ein Problemverständnis.
Sebastian: Wenn ich mich auf eine Sache beschränken muss, dann würde ich den lebendigen Austausch mit anderen Menschen nennen, der im Projekt ja mit im Zentrum steht.
Christos: Ja, es ist zum Beispiel immer schön, wenn Workshops in Präsenz durchgeführt werden können; das körperliche Anwesendsein und das Teilen eines physischen Raums befördert eine ganz andere dialektische Dynamik als Kacheln auf dem Bildschirm (was natürlich auch Vorteile hat). Überhaupt ist es immer wieder spannend zu sehen, wie ethische Konzepte im Dialog dann ihren Weg in die Anwendung finden.
Die Auseinandersetzung mit den Themenfeldern KI und Learning Analytics in der Hochschulbildung in Nordrhein-Westfalen ist vielfältig, dynamisch und von unterschiedlichen Akteur*innen und deren Expertisen geprägt. Das Projekt KI:edu.nrw hat den Auftrag diese unterschiedlichen Expert*innen zu vernetzen und den thematischen Austausch untereinander in verschiedenen Formaten zu fördern. Neben Vernetzungsmaßnahmen bietet das Projekt regelmäßige Informationsveranstaltungen und landesweite Beratungen und Schulungen im Bereich generativer Künstlicher Intelligenz und Learning Analytics an.
Erfahren Sie hier mehr zum Thema Vernetzung und Dialog!